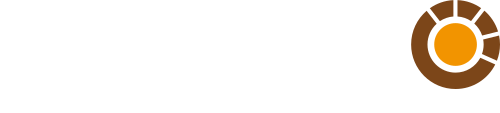Wir erinnern uns an die gegensätzlichen Resultate der letzten beiden Wahlen: 2019 – auf dem Höhepunkt der Klimabewegung – schwappte eine “grüne Welle” über das Land, während das konservative Lager, allen voran die SVP, ein überraschend schwaches Resultat zu verdauen hatte. 2023 drehte der Wind: die SVP war wieder im Hoch, Grüne und die GLP mussten stark Federn lassen.
Doch verändern solche Wahlergebnisse überhaupt etwas in der Schweizer Politik? (Zumal viele Leute nur den Volksabstimmungen einen direkten politischen Einfluss zubilligen.) Mit dem Ende der Herbstsession stehen wir genau in der Halbzeit der 52. Legislaturperiode. Zeit also, die Entscheide des Nationalrats der letzten zwei Jahre mit der vorangegangenen Legislatur zu vergleichen.
Unsere Parlamentsbeobachtung-Plattform “smartmonitor” erstellt seit der Wintersession 2019 regelmässig thematische Ratings. Zu diesem Zweck werden die Abstimmungen im Nationalrat einzeln danach beurteilt, ob sie sich für die Berechnung eines von insgesamt zehn thematischen Ratings eignen. Die vorliegende Analyse nutzt diese thematische Zuteilung der Nationalratsabstimmungen und fragt sich, wie erfolgreich die einzelnen Parteien bei diesen Abstimmungen waren. Erfolg pro Partei wird hier als der durchschnittliche Anteil einer Partei definiert, dessen Stimmverhalten mit dem obsiegenden Ergebnis des gesamten Nationalrats übereinstimmt.1
Die Ergebnisse der Untersuchung in der untenstehenden Abbildung zeigen nun für jede der sechs grossen Schweizer Parteien die Erfolgsrate pro Themenfeld. Die Auswertung zeigt einerseits sehr schön, dass der Erfolg einer Partei erheblich vom Themenbereich abhängt. Während der durchschnittliche Erfolgsanteil der SVP im Bereich der Aussenbeziehungen bei unter 30% liegt, erreicht er bei wirtschafts- und umweltpolitischen Abstimmungen fast 75%. Ähnliche Differenzen lassen sich auch bei SP und Grünen finden, während die Unterschiede bei den Parteien im politischen Zentrum etwas geringer ausfallen.
Das hauptsächliche Augenmerk liegt in diesem Beitrag jedoch auf dem Wechsel von der 51. zur 52. Legislaturperiode: Was lässt sich in Bezug auf die inhaltlichen Auswirkungen des Wahlergebnisses anhand der Veränderungen der thematischen Erfolgsraten ablesen? Der Blick auf die Grafik zeigt einerseits Themenbereiche, bei denen deutliche Veränderungen der Erfolgsraten erkennbar sind. Am auffälligsten ist dies beim Umweltschutz der Fall, wo gleich bei vier Parteien grosse Differenzen auftreten: Grüne und SP verzeichnen eine stark sinkende Erfolgsquote, während SVP und – etwas überraschend vielleicht – die GLP deutlich häufiger auf der Gewinnerseite stehen. Bei FDP und der Mitte sind hingegen kaum Unterscheide festzustellen. Es liegt somit nahe, dass der Nationalrat in der laufenden Legislatur eine bürgerlicher ausgerichtete Umweltpolitik betreibt als in den vier Jahren davor.
Denselben Eindruck erhält man, wenn man auf die Analyse der Abstimmungen schaut, die den klassischen sozio-ökonomischen Links-rechts-Gegensatz betreffen (d.h. im Wesentlichen Fragen des sozialen Ausgleichs und der Verteilung von Einkommen und Vermögen). Auch hier haben alle Zentrums- sowie rechtsstehenden Parteien in der aktuellen Legislatur mehr Erfolg, während SP und Grüne häufiger auf der Verliererseite stehen. Dies bildet sich im Übrigen auch bei Abstimmungen zur Wirtschaftspolitik sowie zu Steuern und Finanzen ab.
Fokussiert man hingegen auf Abstimmungen, welche die soziale Wohlfahrt – den Sozialstaat im engeren Sinne – betreffen, ändert sich das Bild. In diesem Bereich sind alle Parteien in der laufenden Legislatur erfolgreicher, mit Ausnahme der SVP, bei der ein gegenläufiger Trend festzustellen ist.
In den Entscheiden des Nationalrats seit 2023 lassen sich somit durchaus Auswirkungen der letzten Wahlen erkennen. Insbesondere im Umweltbereich, was sich mit der Schwächung der grünen Parteien bei gleichzeitiger Stärkung der SVP gut erklären lässt. Auch in ökonomischen Fragen (Wirtschaftspolitik, Verteilungsfragen, Steuern) sind die bürgerlichen Parteien erfolgreicher geworden. Allerdings gibt es auch Bereiche, bei denen sich insgesamt wenig Veränderungen zeigen (z.B. Abstimmungen zu sozio-kulturellen Themen) oder die sogar eine entgegengesetzte Tendenz aufweisen (soziale Wohlfahrt).
Zum Schluss sei auf einige Problempunkte der Analyse hingewiesen, die bei der Interpretation der Ergebnisse zu bedenken sind:
- Erstens handelt es sich um eine Abstimmungsauswahl, die vom Team des smartmonitor-Projekts bestimmt wurde. Dabei kamen zwar einheitliche Kriterien zur Anwendung, dennoch kann man bei einzelnen Abstimmungen durchaus auch anderer Meinung bezüglich der Zuteilung zur den zehn Themenbereichen sein.
- Zweitens ist man bei der Auswahl der Abstimmungen immer davon abhängig, über welche Vorlagen das Parlament abstimmt. Bei der Auswahl handelt es sich um eine bunte Mischung aus Motionen und parlamentarischen Initiativen (die beide primär die politischen Vorlieben und das Kalkül einzelner Ratsmitglieder oder Parteien abbilden) sowie aus Bundesratsvorlagen. Bei der thematischen Zuteilung der Abstimmungen wird nicht auf die politische Balance oder eine thematische Ausgewogenheit geachtet. Wenn also z.B. die SVP das Migrationsthema mit regelmässigen, aber praktisch chancenlosen Vorstössen dominiert, dann bildet sich dies auch in der Abstimmungsauswahl in diesem Bereich ab. Es handelt sich letztlich um die parlamentarische Realität, in der so etwas wie “objektive Relevanz” kein Kriterium darstellt.
- Drittens folgt daraus, dass die Analyse keine Aussage über substanzielle Veränderungen in den einzelnen Politikbereichen macht. Um wieder das Migrationsbeispiel heranzuziehen: Dass die SVP einen geringen Erfolgsanteil in diesem Bereich aufweist, heisst keineswegs, dass sie keinen grossen Einfluss nehmen würde. Gerade dieses Beispiel zeigt, dass eine Partei den anderen mittels Volksabstimmungen und Druck der Öffentlichkeit einen bestimmten Kurs aufzwingen und die Ausrichtung der Politik nachhaltig beeinflussen kann, ohne dass sie sich im Parlament besonders kooperativ und somit erfolgreich verhalten muss.
1 Vgl. https://smartmonitor.ch/de/analyses/3
Die folgende Tabelle stellt zudem die zehn Politikbereiche und die Anzahl der Nationalratsabstimmungen dar, die in die Analyse einfliessen. Ersichtlich ist, dass alle Bereiche in beiden Legislaturperioden eine grössere Zahl an Abstimmungen aufweisen, was die Aussagekraft der Untersuchung stützt. Die inhaltliche Definition der einzelnen Bereiche, nach der die Auswahl der Abstimmungen vorgenommen wird, sowie die ausgewählten Abstimmungen selbst können online unter https://smartmonitor.ch/de/analyses beim jeweiligen thematischen Rating nachgeschaut werden.
| Anzahl Abstimmungen 2019-2023 | Anzahl Abstimmungen 2023-2025 | |
| Aussenbeziehungen | 32 | 63 |
| Wirtschaftspolitik | 72 | 71 |
| Steuern & Finanzen | 68 | 93 |
| Law & Order | 24 | 44 |
| Migration & Integration | 48 | 62 |
| Umweltschutz | 52 | 60 |
| Soziale Wohlfahrt | 31 | 35 |
| Gesellschaftspolitik | 23 | 20 |
| Links-rechts (sozio-ökonomische Dimension) | 109 | 91 |
| Liberal-konservativ (sozio-kulturelle Dimension) | 83 | 100 |